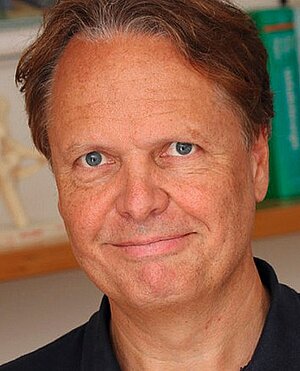Nachdruck einer Kolumne aus dem Ärztenachrichtendienst (ÄND) online am 21.06.2025.
Geht es nach dem neuen Koalitionsvertrag, wird das Primärarztsystem verbindlich eingeführt. Dem Hausarzt soll dabei die Rolle des Lotsen zufallen. So soll die Zahl der Arztbesuche reduziert werden. Die anfängliche Begeisterung für dieses System weicht jedoch langsam einer gewissen Ernüchterung. Ich selbst fand die Idee eines Primärarztsystems lange Zeit nicht schlecht. Doch je konkreter die Pläne dafür diskutiert werden, umso skeptischer werde ich. Auch viele Hausärzte fragen sich inzwischen, ob das Lotsendasein für sie wirklich erstrebenswert ist.
Hier ein paar Entscheidungshilfen:
Wer wissen will, wie Lotsen arbeiten, sollte es sich in Hamburg einmal ansehen, am besten an einem meiner absoluten Lieblingsorte, dem Restaurant Engel auf dem Fähranleger Teufelsbrück. Das gläserne Restaurant thront auf einem Ponton in der Elbe, von dem die Lotsenschiffe ablegen, die die Hafenlotsen zu den großen Schiffen hin und zurück transportieren. Wenn die kleinen Transportschiffe ablegen, schwankt der ganze Ponton und mit ihm die Fischsuppe im Teller. Im Laufe eines Abends passiert das ziemlich häufig. Bis zu acht Schiffe versorgt ein Lotse pro Schicht. Und während er seiner Lotsentätigkeit nachgeht, stehen auf dem Weg in den Hamburger Hafen weitere Kapitänskollegen auf der Brücke ihrer Schiffe. Es gibt also deutlich mehr Kapitäne als Lotsen.
Um Hafenlotse zu werden, braucht man ein Patent als Kapitän auf großer Fahrt und einige Jahre Berufserfahrung auf See. Kapitäne, die sich entschließen, fortan als Lotse zu arbeiten, haben dadurch Vor- und Nachteile. Einerseits ist das Lotsendasein so etwas wie das Homeoffice der christlichen Seefahrt. Man kann abends im eigenen Bett schlafen. Andererseits haben sich die meisten Kapitäne ursprünglich etwas Aufregenderes vorgestellt. Als Hafenlotse ist man schließlich nicht mehr zwischen Hamburg und Haiti unterwegs.
Ärzte als Lotsen
Kann man da eine Parallele zum ärztlichen Lotsenwesen ziehen? Ja, und das wurde mir klar, als kürzlich im Gespräch war, dass auch Fachärzte eine Lotsenfunktion übernehmen sollten. Dieser Vorschlag machte mir deutlich, dass dies nichts ist, was ich persönlich in meiner aktiven Zeit als Kassenarzt freiwillig gemacht hätte.
Denn als ich mich für meinen Beruf und meine Fachrichtung entschied, hatte ich andere Vorstellungen als die, mich vorwiegend mit der Frage zu beschäftigen, ob eine Überweisung ausgestellt werden sollte. Ich wollte selbst Diagnosen stellen, behandeln und Patienten beraten. Die Überweisung sah ich nur als Unterstützung meiner eigenen Tätigkeit an. Doch das gilt nicht nur für mich und andere Fachärzte.
Soyka: „Wer als Arzt vorwiegend mit der Selektion von Überweisungsnotwendigkeiten beschäftigt ist, hat weniger Kapazitäten für seine eigentliche Tätigkeit.“
Die meisten noch praktizierenden Hausärzte dürften das genauso sehen. Die meisten sind vermutlich lieber Kapitän als Lotse. Viele erinnern sich wehmütig an frühere Zeiten, als es noch große Hausarztpraxen gab, die ein großes Spektrum vorhielten, das auch EKG, Ultraschall, physikalische Therapie und andere Leistungsangebote enthielt, die man vielleicht nur bei Fachärzten erwarten würde. Ich kenne noch Hausärzte, die kleine Operationen oder gynäkologische Untersuchungen durchführten. Manche Fachärzte dürften sich darüber geärgert haben, aber die Arbeitszufriedenheit dieser alten Hausärzte schien mir immer sehr hoch zu sein. Heutzutage entsprechen immer weniger Praxen diesem Bild, von den meisten privaten MVZ einmal ganz abgesehen. An die Stelle einer kleinen Wundversorgung oder einer Chirotherapie tritt das Assessment und das Formularausfüllen. In der jungen Ärztegeneration trauen sich daher viele die alte Kapitänsrolle gar nicht mehr zu. Kein Wunder, dass es schwerfällt, Nachfolger für Hausarztpraxen zu finden.
Überflüssige Arztbesuche – ein Fallbeispiel
Doch die ärztliche Lotsentätigkeit wird für wichtig erachtet, um überflüssige Arztkontakte zu vermeiden. Ein nachvollziehbares Argument angesichts zunehmender Wartezeiten.
Erst vor ein paar Tagen erzählte mir ein radiologischer Kollege von einem Patienten, der innerhalb von vier Wochen drei Überweisungen zu MRTs der gleichen Körperregion von drei verschiedenen Ärzten erhalten hatte. Hier wäre mehr Koordination wirklich wünschenswert.
Doch wie viele solcher Fälle gibt es? Und könnte ein Primärarztsystem solche Fälle wirklich wirksam verhindern?
Wie bei der Number needed to treat wäre es interessant zu wissen, wie viele Facharztkontakte von einem Lotsen zusätzlich untersucht werden müssen, um eine überflüssige Untersuchung zu verhindern.
Eine weitere Frage ist, ob es durch ein Primärarztsystem überhaupt zu einer Reduktion der Arztkontakte kommen kann.
Zehn Arztbesuche im Jahr – beim Facharzt und beim Hausarzt
Es heißt, dass die Deutschen im Schnitt auf zehn Arztbesuche pro Jahr kommen und damit einen Spitzenplatz in der Welt erreichen. Leider finde ich (ebenso wie alle KI‘s und Googles, die ich konsultierte) keine Angaben darüber, wie viele dieser Konsultationen beim Facharzt- und wie viele beim Hausarzt stattfinden. Der Allgemeinmediziner Prof. Martin Scherer gibt in einem Interview mit dem KVHH Journal an, dass die Deutschen im Schnitt 1,7 Hausärzte haben. Das könnte, wenn diese Hausärzte in allen vier Quartalen besucht werden, dafür sprechen, dass die Hausarztkonsultationen mindestens die Hälfte der 10 Arztbesuche repräsentieren. Dann würde ein Primärarztsystem die Zahl der Arztkontakte nur weiter nach oben treiben. Aber anscheinend hat sich um diese Frage niemand explizit gekümmert, bevor man sich für das Primärarztsystem starkmachte.
Eine andere Geschichte aus der Praxis, die ich ebenfalls erst vor ein paar Tagen erfuhr, scheint diese Sichtweise zu unterstützen und verstärkte meine aufkommenden Zweifel an der Nützlichkeit des Primärarztsystems.
Fallbeispiel 2: Eine iatrogene Odyssee
Eine Privatpatientin berichtete mir von ihrem 80-jährigen Ehemann, der nicht nur Kassenpatient, sondern auch in einem Hausarztmodell eingeschrieben ist. Der alte Mann verspürte plötzlich einen heftigen Rückenschmerz, den er vorher nicht kannte. Für eine Überweisung zu einem Orthopäden suchte er seinen Hausarzt auf. Doch der wollte ihn zunächst zum Röntgen schicken, überwies ihn zum Radiologen. Den Radiologen-Termin bekam er 14 Tage später. „Beim Orthopäden hätte er ja sofort das Röntgen bekommen, so wie bei Ihnen,“ sagte die Patientin. Beruhigend war wenigstens, dass sich im Röntgenbild keine Ursache für die Beschwerden des Patienten finden ließ, dafür sehr viel „altersgemäßer Verschleiß“. Weil aber bei dem Patienten vor 20 Jahren ein Prostatakarzinom (abgekapselt und weit im Gesunden) entfernt worden war, schlug der Radiologe vor, zunächst einen Urologen zu konsultieren.
Der Hausarzt (dritter Arztbesuch) überwies jetzt zum Urologen (vierter Besuch). Der sah den Patienten, der währenddessen eine psychische Achterbahnfahrt durchlitt, einige Wochen später. Doch der Urologe gab sofort Entwarnung. „Der Urologe hat laut gelacht“, berichtet mir die Patientin. Für eine Metastasierung habe es nicht den geringsten Anhalt gegeben. Das PSA, das einige Wochen zuvor abgenommen war, läge bei 0,1. Der Urologe empfahl, einen Orthopäden aufzusuchen, also genau das, was der Patient sowieso schon gerne gehabt hätte. Zunächst musste er sich jedoch noch einmal bei seinem Hausarzt vorstellen, der dann auch die gewünschte Überweisung ausstellte. Es kam damit zur fünften Konsultation. Wie die Geschichte ausgeht und wie der orthopädische Kollege sich in dieser Sache schlagen wird, weiß ich noch nicht. Der Patient hat zumindest jetzt einen Termin. Die Rückenschmerzen sind immer noch vorhanden.
Kann das Primärarztsystem wirklich funktionieren?
Es kann kein Zweifel daran bestehen, dass man sich um die Reduktion überflüssiger Arztbesuche kümmern muss. Die Beispiele zeigen, dass die Ärzte erstens besser zusammenarbeiten müssen und zweitens auch weiser entscheiden müssen als bisher. Aber wird das durch den Zwang erreicht, immer zuerst einen Primärarzt aufzusuchen?
Man muss sich schon darüber im Klaren sein, dass ein verpflichtendes Primärarztsystem – egal, wie es ausgestaltet ist – eine neue bürokratische Regelung sein wird. Also genau das, was wir sonst so sehr beklagen.
Mein Vorschlag ist deshalb, lieber noch einmal darüber nachzudenken, woran sich überflüssige Arztbesuche erkennen lassen und wie ohne zusätzliche Bürokratie etwas dagegen zu unternehmen ist.
Es erscheint jedenfalls nicht logisch, den Mangel an Arztterminen dadurch beheben zu wollen, einem großen Teil der Ärzte neue oder ganz andere Aufgaben zuzuweisen. Es ist wie bei den Kapitänen auf hoher See. Wer als Hafenlotse tätig ist, fährt keinen Frachter nach Shanghai. Und wer als Arzt vorwiegend mit der Selektion von Überweisungsnotwendigkeiten beschäftigt ist, hat weniger Kapazitäten für seine eigentliche Tätigkeit.
Wenn es plötzlich zu wenig Kapitäne auf den Seeschiffen gäbe, käme jedenfalls niemand auf die Idee, die vorhandenen Seekapitäne zu Hafenlotsen umzuschulen. Stattdessen würde man eher versuchen, den Job als Frachterkapitän attraktiver zu machen. Denn nur so ließe sich der Mangel beheben. Das gilt für Ärzte ganz genauso.
Dr. med. Matthias Soyka
Zum Autor: Der Orthopäde und Buchautor Dr. med. Matthias Soyka (Foto) aus Hamburg schreibt regelmäßig Kolumnen für den Ärztenachrichtendienst.
Die Beiträge in der Rubrik „Ansichten & Einsichten“ geben nicht unbedingt die Meinung der Redaktion wieder.