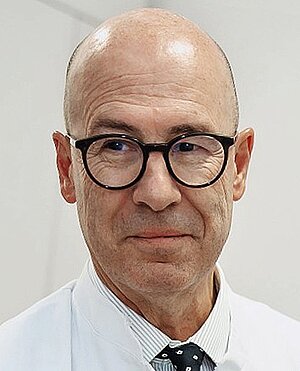Definition des Post-Covid- Syndroms
Die Covid-19-Pandemie, die durch die WHO von März 2020 bis Mai 2023 eingegrenzt worden ist, hat sich auch in hoch entwickelten Gesundheitssystemen als starke Herausforderung erwiesen. Neben den über sieben Millionen weltweit zu beklagenden Todesopfern konnten bei zahlreichen Überlebenden der Infektion erheblich einschränkende Folgezustände registriert werden, die über Monate bis Jahre und teilweise bis heute anhalten.
Die WHO hat das Post-Covid-Syndrom (PCS) im Delphi-Konsens-Verfahren am 6.10.2021 definiert. Danach tritt dieses innerhalb von drei Monaten nach einer SARS-CoV-2-Infektion mit Symptomen auf, die mindestens zwei Monate andauern, nicht durch eine andere Diagnose zu erklären sind und sich auf den Tagesablauf auswirken. Die Symptome können nach anfänglicher Genesung neu auftreten, die initiale Erkrankung überdauern, fluktuieren und mit der Zeit wiederkehren [1]. Nach einer willkürlichen zeitlichen Definition wird zwischen Post- und Long-Covid-Syndrom differenziert. In der Klinik des Autors wird der Begriff Long-Covid vermieden, da er im Sinne eines Nocebo-Effektes eine langandauernde oder bleibende Einschränkung suggeriert.
Neuropsychiatrische Symptomatik
Wenngleich in der akuten Infektion mit SARS-CoV-2 kardiopulmonale Symptome vorherrschten, wird das klinische Bild des PCS ganz überwiegend von neurologischen, neuropsychiatrischen und neuropsychologischen Symptomen geprägt. Die Betroffenen berichten vorrangig über Fatigue, kognitive Störungen („brain fog“) und Schmerzen in unterschiedlichen Körperregionen, sehr häufig Kopfschmerzen. Auffällig korreliert das Ausmaß des PCS in den allermeisten Fällen nicht mit dem Schweregrad der Akutinfektion. So waren zahlreiche neuropsychiatrische Symptome bei den Patienten, die nicht intensivmedizinisch oder stationär behandelt worden waren, häufiger als bei den initial hospitalisierten Patienten und stiegen im Verlauf noch an [2].
Erklärungsmodelle
Unverändert sind die dem PCS zugrunde liegenden pathophysiologischen Mechanismen trotz zahlreicher labortechnischer und bildgebender Detailbefunde noch ungeklärt. Hauptsächlich werden folgende Prozesse als relevant eingeschätzt [3]:
- Viruspersistenz bzw. -reaktivierung
- Autoimmunprozesse
- Endotheliale Dysfunktion
- Mitochondriale Dysfunktion
- Veränderung des (enteralen) Mikrobioms
- Autonome Dysregulation
Weiterhin stellt sich die Frage, inwieweit es sich bei diesen Erkenntnissen um tatsächlich richtungsweisende Befunde hinsichtlich einer allgemein akzeptierten wissenschaftlichen Hypothese zum PCS handelt, oder diese lediglich als Epiphänomene anzusprechen sind. Eine sorgfältig durchgeführte Studie an 171 PCS-Patienten ergab hinsichtlich klinisch-neurologischer Untersuchung, umfassender Neurophysiologie, kraniellem MRT und Liquoranalyse lediglich in 1,7 % auffällige Befunde. Allerdings ergab sich Evidenz für signifikante psychische Komorbidität und hohe Somatisierungslevel [4].
Die Rolle psychosomatischer Aspekte hinsichtlich Prädisposition, Auslösung und Aufrechterhaltung des PCS wird sowohl in der Fachwelt wie auch noch mehr in der Öffentlichkeit teils leidenschaftlich diskutiert. Auf die in diesem Kontext schwierige Überlappung der Symptomatik des PCS mit dem Syndrom der myalgischen Enzephalitis/chronic fatigue (ME/CFS) wird weiter unten eingegangen.
Rehabilitative Ansätze
Da medikamentöse und apparative Verfahren wie hyperbare Sauerstofftherapie, transkranielle Gleichstromstimulation und Plasmaaustausch [5] praktisch keine relevanten Therapieeffekte aufweisen, wie ein aktuelles systematisches Review belegt [6], rücken zwangsläufig rehabilitative Verfahren in den Fokus.
Als eine Stärke der in Deutschland üblichen Rehabilitation gilt der umfassende bio-psycho-soziale Ansatz [7]. Problematisch ist, dass insbesondere der psychologische Zugang von zahlreichen PCS-Betroffenen nicht akzeptiert und jegliche Möglichkeit psychischer Mitbeteiligung am Beschwerdebild konsequent abgelehnt wird. Es wird eine Nähe zu dem zwar ätiologisch umstrittenen, aber syndromal weitgehend anerkannten ME/CFS hergestellt und dortige Therapiekonzepte werden auf das PCS übertragen.
Hierzu gehört die Anstrengungsintoleranz („Post-Exertional Malaise“), welcher durch „Pacing“, der strikten Vermeidung, die individuelle momentane Belastungsgrenze zu erreichen oder zu überschreiten, entgegengewirkt werden soll. Das Ziel ist, dramatische Rückfälle („Crashs“) zu vermeiden. Diese oft sehr eindrucksvoll demonstrierten Crashs bis hin zu mehrtägiger Rollstuhlpflichtigkeit und Unfähigkeit, das Bett zu verlassen, stehen bewährten Konzepten der Neurorehabilitation mit sich steigernder, an die zunehmende Belastbarkeit angepasster Trainingsintensität („Shaping“) entgegen.
Diese Kontroverse führt zu Veränderungen der Einstellung vieler Patienten zur Sinnhaftigkeit von medizinischer Rehabilitation. In der Begutachtungspraxis des Autors werden zunehmend PCS-Betroffene vorgestellt, die sich nicht in der Lage sehen, eine bereits indizierte und genehmigte Rehabilitationsmaßnahme anzutreten und den Nichtantritt rechtlich durchsetzen wollen.
Erfreulicherweise gibt es in letzter Zeit zunehmend Belege dafür, dass insbesondere Rehabilitationsprogramme, die mehrere Therapiemodalitäten verbinden, zu Verbesserungen von motorischer Leistungsfähigkeit, kognitiven Fähigkeiten und Lebensqualität führen. Dies wurde unter anderem exemplarisch für multidisziplinäre Neurorehabilitation [8], Bewegungstherapie [9], Kognitive Verhaltenstherapie [10] und neuropsychologische Therapie [11] gezeigt.
Für das spezifische deutsche Rehabilitationswesen ist die von der Deutschen Rentenversicherung (DRV) geförderte PoCoRe-Studie zu nennen. Diese prospektive kontrollierte nicht-randomisierte Längsschnittstudie, die über 700 Betroffene in sechs spezialisierten neurologischen und psychosomatischen Rehabilitationskliniken einschloss, konnte signifikante Verbesserungen von Fatigue, Aufmerksamkeit und Gedächtnis bei allerdings geringen bis mittleren Effektstärken nachweisen [12]. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass sich in psychosomatischer Rehabilitation depressive Symptome eher besserten, während neurokognitive Einschränkungen länger überdauerten, was den Schluss nahelegt, dass diese nicht ausschließlich als („pseudodemente“) Symptomatik einer Depression anzusehen sind [13].
Um vor dem Hintergrund der intensiven und öffentlichen Diskussion über den Wert rehabilitativer Maßnahmen bei PCS Erkenntnisse über den Einfluss von Erwartungen der Rehabilitanden auf das Behandlungsergebnis zu erhalten, untersuchten wir 61 Versicherte der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW) drei Monate nach einer vier- bis sechswöchigen stationären Neurorehabilitation in unserer Klinik [14]. Wir nutzten die Generic rating scale for previous treatment experiences, treatment expectations and treatment effects (G-EEE) [15], um positive und negative Behandlungserwartungen und Erwartungen von Nebenwirkungen zu registrieren. Primärer Outcome-Parameter war die krankheitsbedingte Einschränkung, gemessen mit dem angepassten Pain-Disability-Index (PDI). Sekundäre Outcome-Parameter betrafen depressive Symptome (gemessen mit dem Patient Health Questionnaire 9 [PHQ-9]), Angstsymptome (gemessen mit dem Generalizied Anxiety Disorder-7 Scale [GAD-7]), wahrgenommene somatische Symptome (gemessen mit dem Patient Health Questionnaire-15 [PHQ-15]); zusätzlich wurden die Post-Covid-19 Functional Status Scale (PCFS) und die Chalder Fatigue Scale (CFS) ausgewertet. Das körperliche Leistungsvermögen wurde mit dem 6-Minuten-Gehtest (6-MWT), neuromentale Fähigkeiten mit einer standardisierten neurokognitiven Untersuchung gemessen. Außerdem wurden Entzündungsmarker im Serum bestimmt. Messpunkte waren zu Beginn der Rehabilitation (T0), bei Abschluss der Rehabilitation (T1) und drei Monate nach Rehabilitation (T2) (Details der statistischen Analyse siehe unter [14]).
Die Auswertung ergab signifikante Assoziationen zwischen den Erwartungen der Patienten und dem Behandlungsergebnis. Zusammenfassend waren höhere Nebenwirkungserwartungen zu T0 moderat assoziiert mit größerer krankheitsbedingter Einschränkung, reduzierter körperlicher Fitness und mehr somatischen Symptomen zu T2. Höhere positive Behandlungserwartungen zu T0 waren moderat assoziiert mit einem geringeren funktionellen Status (PCFS) zu T2. Alle anderen Assoziationen waren nicht statistisch signifikant nach umfassender Adjustierung [14].
Zusammenfassend zeigen die Ergebnisse, dass die Erwartungen der Patienten signifikant assoziiert sind mit physischen und psychischen Behandlungsergebnissen. Insbesondere Nebenwirkungserwartungen erwiesen sich als entscheidender Faktor. Überraschenderweise waren sehr positive Behandlungserwartungen assoziiert mit schlechterem funktionellen Status. Dieses Ergebnis steht im Kontrast zu bisherigen rehabilitativen Erfahrungen, auch zu schon existierender Literatur. Eine mögliche Erklärung für dieses unerwartete Ergebnis könnte sein, dass eine sehr positive Erwartung der Patienten in die Rehabilitation sich als zu optimistisch oder unrealistisch erwies. Die Differenz zwischen diesen Erwartungen und den tatsächlich eingetretenen Behandlungsergebnissen kann Erwartungsverletzungen (Expectation violations [16]) nach sich ziehen. Diese Hypothese – wenn sie zuträfe – sollte wichtige Konsequenzen für die klinische und rehabilitative Praxis haben.
Versuch einer Synthese
Obwohl die überwiegende Mehrzahl PCS-Betroffenen im Laufe von 18 Monaten eine Besserung erfährt und über die Hälfte sogar symptomfrei wird [17], bleibt ein hoher Bedarf an Rehabilitation, um die weiterhin an neuropsychiatrischen Beschwerden Leidenden bestmöglich sozial und beruflich wieder einzugliedern. Dass hohe Somatisierungsanteile und psychiatrische Komorbiditäten, die häufig vorbestehen, vorhanden sind [17], bestätigt die Notwendigkeit psychosomatischer, aber auch somatisch kompetenter Zugänge zu den Patienten. Die Behandlungskonzepte sollten sich aus der individuellen Belastbarkeit angepasster Physiotherapie und sporttherapeutischen Elementen, Psychotherapie in Einzel und Gruppe, bedarfsweise Ergo- und Logopädie, Riechtraining bei An-/Hyposmie, Entspannungsverfahren und Achtsamkeitsübungen zusammensetzen. Gute Erfahrungen haben wir mit musiktherapeutischen Elementen gemacht.
Ein wichtiges und vertrauensbildendes Element in der therapeutischen Beziehung ist die sorgfältige Bewertung der bisherigen organischen Abklärung. Kardiologische und pneumologische Befundberichte liegen in der Regel bei Aufnahme in die Neurorehabilitation vor. Die neurologische Diagnostik wird bedarfsweise vervollständigt, wobei wir in unserer Klinik die Möglichkeit zu umfangreicher Neurophysiologie, Bildgebung und qualifizierter neuropsychologischer Untersuchung nutzen.
Die Behandlung der häufig nachhaltig beeinträchtigten Patienten ist anspruchsvoll, ein gemeinsames Behandlungskonzept zu entwickeln, herausfordernd. Eingangsvoraussetzung ist regelhaft die Rehabilitationsfähigkeit der Phase D nach der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (BAR), das heißt selbstständiges Bewegen im Stationsrahmen, selbstständige Körperpflege und das Aufsuchen des Speisesaals zu den Mahlzeiten. Viele PCS-Betroffene beklagen eine messbar deutlich eingeschränkte körperliche Belastbarkeit [18] und eine erhöhte Sensibilität auf Außenreize (vor allem Geräusche). Diese Probleme versuchen wir mit Kompromissen bei den Essenszeiten und situativ angepassten Therapieplänen zu lösen, was eine hohe Flexibilität aller Beteiligten erfordert.
Mittlerweile konnte überzeugend nachgewiesen werden, dass Neurorehabilitation wirksam ist. Unsere Untersuchung [14] hat gezeigt, wie entscheidend Erwartungen der Betroffenen das Rehabilitationsergebnis beeinflussen können. Jegliches therapeutische Personal – nicht nur, aber besonders der Ärztliche Dienst! – muss sich bewusst sein über diesen starken Einflussfaktor und die Rehabilitanden entsprechend angemessen über Inhalt, Ziel und Prognose einer Rehabilitation aufklären. Zu hohen Erwartungen sollte durch realistische Information begegnet werden, um Enttäuschungen der Rehabilitanden zu verhindern. Mit Patienten in einer solchen angemessenen Form zu kommunizieren, kann helfen, Placeboeffekte zu nutzen und den negativen Einfluss von Noceboeffekten zu reduzieren.
Ein relevantes Problem für Kliniken, die sich in der Post-Covid-Rehabilitation engagieren, ist die aufgrund der Fatigue deutlich niedrigere Therapiedichte der PCS-Patienten insbesondere am Beginn der Rehabilitation. Dies führt beispielsweise in der Logik der Qualitätssicherung der DRV zu einer Abwertung und damit Minderbelegung der behandelnden Einrichtung. Hier besteht dringender Klärungsbedarf.
Dr. med. Christoph Berwanger, Ärztlicher Direktor/Chefarzt Neurologie, Hardtwaldklinik I, Hardtstr. 31, 34596 Bad Zwesten, E-Mail via: schulz@hwk1.de
Die Literaturhinweise finden Sie hier.