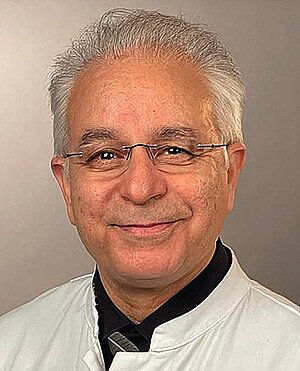Obdachlose Menschen und Menschen in prekären Lebenslagen brauchen besseren und niederschwelligen Zugang zu medizinischer Versorgung. Was können Ärztinnen und Ärzte dafür tun?
Die Gründe für die Obdachlosigkeit und das Leben auf der Straße sind vielfältig und komplex. Bei den einzelnen Faktoren kann man Ursache und Wirkung kaum unterscheiden: Arbeitsverlust, Krankheit, Unfall, Scheidung, Sucht, Haft, etc.
So verliert zum Beispiel ein 40 Jahre alter Mann durch einen Autounfall mit schweren Folgen seine Arbeit. Seine Wohnung ist für Rollstuhlfahrer ungeeignet, eine behindertengerechte Wohnung schwer zu finden. Seine Versuche, sich selbst zu helfen, scheitern. Hilfe bei Ämtern wird, wenn überhaupt, zu spät gesucht: Die Wohnung ist bereits aufgrund von Mietrückständen gekündigt und die Mitgliedschaft in der Krankenversicherung beendet.
Das Leben auf der Straße ist hart: Diese Menschen suchen oft sichere Plätze zum Überleben. Defensive Häuserarchitektur macht das Leben bei schlechten Witterungsverhältnissen schwer. Sie sind oft Opfer von Gewalt und verachtenden Blicke ausgesetzt. Die Lebenserwartung liegt bei Männern um elf Jahre und Frauen acht Jahre unter dem Durchschnitt. 27 % Männer und 13 % der Frauen, die auf der Straße leben, erreichen nicht das 65. Lebensjahr. Die Barrieren, zum Arzt zu gehen, sind vielfältig: Scham, befleckte Kleidung, mangelnde Hygiene, abgelatschte Schuhe, Hab und Gut in Tüten, Sprachbarrieren und ablehnende Blicke. Aus diesen Gründen ziehen viele Betroffene die Anonymität vor und gehen aus ländlichen Regionen in die Städte.
Hilfe wird erst bei hohem Leidensdruck gesucht
Obdachlose Menschen gehen häufig erst dann zum Arzt oder in die Notaufnahme, wenn der Leidensdruck nicht mehr auszuhalten ist. Im Warte- und Behandlungszimmer treten sie unsicher auf, oft mit gesenktem Kopf. Beim Gespräch gibt es kaum direkten Blickkontakt – ein Zeichen der erlebten schlechten Erfahrungen und des Mangels an Vertrauen in die Mitmenschen. Betroffene haben häufig Schwierigkeiten, ihre (gesundheitlichen) Probleme offen zu schildern: halbe, nicht zu Ende gesprochene Sätze, unsichere Sprache, Andeutungen. Sie neigen zu einer Bagatellisierung ihres Leidens. Der Hinweis, der Aufenthalt solle nicht lange dauern und möglichst wenig Untersuchungen umfassen, kommt erfahrungsgemäß vor allem von ehemaligen Privatversicherten, die heute in Armut leben.
Zu wenig Zeit für Zuwendung
Das Arzt-Patient-Gespräch ist oft organbezogen und der körperliche Schmerz ist die häufigste Visitenkarte zum Gespräch, auch wenn der seelische Schmerz umso schwerer wiegt. Die Kolleginnen und Kollegen bemühen sich mit großer Leidenschaft und Hingabe, diesen Menschen in Not zu helfen. Aber die Bürokratie und praktische Hürden in der Versorgung erschweren die ganzheitliche Zuwendung für diese Menschen. So bleibt oft der seelische Schmerz der Einsamkeit bei den Betroffenen zugeschüttet. Gerade diese Menschen, die selten in ihrem ganzen Leben Liebe, Umarmung, Anerkennung, Wertschätzung und Vertrauen erfahren, bräuchten von uns im Sinne unserer Berufung Trost, Hoffnung, Geborgenheit und Nächstenliebe!
Praktische Tipps
Dennoch kann man mit wenig Aufwand viel erreichen. Beispielsweise zu Beginn dem Patienten ermöglichen, seine Tüten mit den Habseligkeiten sicher aufzubewahren oder in das Sprechzimmer mitzubringen. Bieten Sie einen Stuhl an, leichte Berührungen beispielsweise an der Schulter können helfen, Vertrauen aufzubauen. Kurze Gesprächspausen mit nettem Blickkontakt ebenso. Einfühlsame Worte können einen einfachen Einstieg ins Gespräch liefern: „Gut, dass Sie gekommen sind“, „Es ist nicht leicht für Sie, die bestehenden Hürden zu überwinden“, „Sind Sie zum ersten Mal bei uns?“, „Könnten Sie für weitere Behandlungen leicht zu uns finden?“
Es geht erst um nonverbale und verbale Beziehungsarbeit. Präsent sein, die Patienten wahrnehmen und Interesse für sie als Mensch zeigen. „Wie fühlen Sie sich?“, „Wie geht es Ihnen innerlich?“, „Wie kann ich Ihnen helfen?“ Fragen nach der letzten Arbeitsstelle, dem Elternhaus und möglichen noch bestehenden sozialen Kontakten können Sprachbarrieren überwinden, Vertrauen aufbauen und Hintergrundinformationen liefern für weitere Hilfen.
Fallbeispiel aus der Praxis
Ein 25-jähriger Mann mit Typ I-Diabetes hat keinen Kontakt mehr zu den Eltern (beide suchtkrank). Er lebte zehn Jahre vor dem Hauptbahnhof in Frankfurt am Main auf der Straße und ist selbst psychisch krank. Er ging gern freitags zum Betteln vor das Standesamt. Jetzt, durch Bindung an Sozialarbeiter, hat er wieder eine Arbeit gefunden, sogar eine eigene Wohnung mit eigenem Namensschild, Schlüssel, Dusche, Küche und Bett. Er trinkt nicht mehr und ist von weiteren Drogen losgekommen. Trotz seiner schwierigen Biografie hat er eine fröhliche Ausstrahlung behalten.
Man darf nicht vergessen: Menschen sind obdachlos, weil sie krank werden und krank sind. Sie brauchen unsere Hilfe.
Dr. agr. Dr. med. Rahim Schmidt, Kommissarischer fachärztlicher Leiter Hochschulambulanz Uniklinikum Mainz, Zweiter Vorsitzender des Vereins „Armut und Gesundheit in Deutschland“, Botschafter der Stiftung „Lebensspur“, E-Mail: rahim.schmidt@gmx.de
Quellen: Robert Koch-Institut, Deutschlandfunk, Magazin Hinz & Kunz. Der Artikel bezieht sich inhaltlich auch auf einen Beitrag, den der Autor in „Die Innere Medizin, Ausgabe 11/2024“ veröffentlicht hat.
Für sein ehrenamtliches Engagement erhielt Dr. Dr. Rahim Schmidt die Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz. Der Verein „Armut und Gesundheit in Deutschland“ kümmert sich um obdachlose Menschen und Flüchtlinge, die außerhalb der Regelversorgung medizinische Hilfe brauchen. Für Spenden finden sich Informationen auf den Websites
Im Hessischen Ärzteblatt 12/2024 findet sich ein weiterer Beitrag des Autors zur interkulturellen Medizin: „Migrantenmedizin. Kulturelle Vielfalt und Kommunikation.“