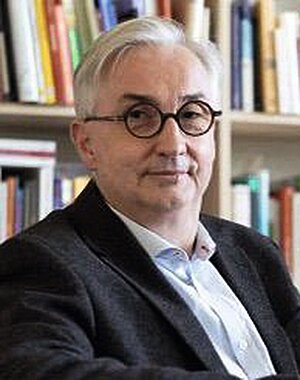Als ich am 2. Januar 1980 meinen Zivildienst auf der Männeraufnahmestation am Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf (UKE) begann, betrat ich eine für mich bis dahin unbekannte Welt. Auf der Station „Kraepelin“ existierte neben 2- bis 4-Bett-Zimmern ein Wachsaal mit bis zu acht Männern. Diese lagen, auf ca. 35- bis 40 Quadratmetern, nur getrennt durch eine ca. 130 cm hohe Mauer, nebeneinander. Zusätzlich gab es noch ein Isolierzimmer, in dem die tobenden und fixierten Patienten mehr oder weniger sich selbst überlassen blieben.
Zu Beginn meiner Tätigkeit durften von den Patienten keine Messer und Gabeln auf der Station benutzt werden, das Essen wurde vorgeschnitten. Vom Pflegezimmer aus konnte direkt, nur durch Glasbausteine etwas verzerrt, auf die Toiletten geschaut und die Patienten kontrolliert werden. Die am wenigsten qualifizierten, die drei bis vier Zivildienstleistenden, waren im unmittelbaren Umgang mit den Patienten im Wachsaal. Weibliche Mitarbeiterinnen gab es auf der Station nicht.
Das „Außengelände“ war ca. 80- bis 100 Quadratmeter groß, von einer ca. fünf Meter hohen Mauer umgeben, so dass neben der Wiese nur noch der Himmel betrachtet werden konnte. Auch wenn dieses Außengelände der Sicherung für die forensischen Gutachtenpatienten diente, die gelegentlich auf der Station untergebracht waren, hatten doch alle darunter zu leiden. Es gab eine Eingangsschleuse, die zwei getrennt voneinander zu bedienende Türen hatte. Die psychiatrische Klinik am UKE wurde als moderner Bau 1971 eröffnet, damit nicht nur architektonisch, sondern auch von der Art und Weise wie „moderne Psychiatrie“ auszusehen habe, ein Spiegelbild der Zeit vor der Reform der Psychiatrie.
Der Abschlussbericht „zur Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik“ (Psychiatrie-Enquête), der die Missstände erstmals durch eine politisch legitimierte Sachverständigenkommission öffentlich machte, wurde am 25. November 1975 der damaligen Gesundheitsministerin Dr. Katherina Focke übergeben.
Die psychiatrische Klinik am UKE war aber nicht nur ein Relikt aus der „alten Psychiatrie“, vielmehr auch eine der Keimzellen einer neuen Entwicklung. Es gab offene, spezialisierte Stationen, eine Tagesklinik, eine Institutsambulanz, ein ambulantes Versorgungszentrum in einem Stadtteil. Auch personell spiegelte sich die alte, mit dem Nationalsozialismus verbundene und die um Veränderung bemühte Psychiatrie wider. So war der langjährige Ordinarius für Psychiatrie und Neurologie Prof. Dr. med. Hans Bürger-Prinz seit 1936 bis einschließlich 1965 ärztlicher Direktor der Psychiatrie am UKE. Ein Mann, der als ehrenamtlicher Richter beim Erbgesundheitsgericht, das über Zwangssterilisationen entschied, und im wissenschaftlichen Beirat beim Bevollmächtigten für das Gesundheitswesen, Prof. Dr. med. Karl Brandt, aktiv war. Brandt war Leibarzt Adolf Hitlers und wurde im Rahmen der Nürnberger Prozesse verurteilt und hingerichtet. Bürger-Prinz’ Nachfolger als Ordinarius hingegen, Prof. Dr. med. Jan Groß, überlebte das Lager in Bergen-Belsen, war ausgewiesener Sozialpsychiater und Vorgesetzter von einigen der wichtigen Psychiatriereformer*innen, wie Prof. Dr. med. Klaus Dörner, Prof. Dr. med Andreas Spengler, Prof. Dr. phil. Thomas Bock und Dr. med. Charlotte Köttgen.
In welcher Lage befand sich die Psychiatrie unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg?
Die psychiatrischen Anstalten waren in einem erbärmlichen Zustand. Waren in ihnen zwischen 1940 und 1945 im Rahmen der systematischen und der „wilden Euthanasie“ mehr als 300.000 psychisch kranke und geistig behinderte Menschen ermordet, fast 400.000 erkrankte Menschen und/oder deren Angehörige zwangssterilisiert, jüdische und politisch unliebsame Psychiater*innen vertrieben oder ermordet worden, wurden nun die Anstalten zu anderen Zwecken ge-/missbraucht. In ihnen lebten zum Teil unter menschenunwürdigen Bedingungen ehemalige Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, Alte, körperlich Kranke, Obdachlose, letztlich Menschen, die keine psychiatrische Versorgung brauchten, für die es aber keine anderen Orte gab. Unter diesen Bedingungen ist es nicht verwunderlich, dass das Sterben in den Anstalten nicht nachließ, vielmehr noch bis Ende der 1940er-Jahre zunahm. Prof. Dr. phil. Cornelia Brink schreibt dazu: „Das Massensterben in den Anstalten endete nicht am 8. Mai 1945; im Gegenteil erreichte die Sterblichkeit in diesem Jahr in fast allen deutschen Anstalten mit Sterberaten bis zu 50 % ihren Höhepunkt.“ Zudem wurde seitens der Aufsichtsbehörden eine deutliche Erhöhung der Belegungsdichte bei einer Reduzierung des Pflegepersonals und der Kosten für die Ernährung eingefordert. Auch bei den Mitarbeitenden zeigte sich eine Kontinuität. Zwar wurde unmittelbar ab Mai 1945 seitens der jeweiligen Militärregierungen die Mehrheit der Mitarbeitenden entlassen, in der Heil- und Pflegeanstalt Gießen waren dies z. B. von 110 Beschäftigten 76, es gelang aber vielen Entlassenen, nach der so genannten Weihnachtsamnestie 1946, wieder eingestellt zu werden. Daneben war die Qualifikation häufig unzureichend bis schlecht. Prof. Dr. med. Klaus Beine schreibt dazu: „Die personelle Kontinuität war ungebrochen. Von wenigen Ausnahmen abgesehen, betrieben dieselben Ordinarien und Chefärzte unter der Flagge der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nach 1945 dieselbe Psychiatrie wie zuvor für Führer, Volk und Vaterland.“ Es gab offensichtlich Wichtigeres als die Reform psychiatrischer Kliniken.
Im Vorfeld der Psychiatrie-Enquête
Zusammenfassend bestand bis weit in die 1970er-Jahre die alte Anstaltspsychiatrie mit fast allen Miss- und Stillständen fort. Prof. Dr. med. Heinz Schott und Prof. Dr. med. Rainer Tölle fassen die Situation wie folgt zusammen: „1970 noch hatte kaum ein Krankenhauspatient ein eigenes Schrankfach, viele hatten keine eigene Kleidung, die meisten waren in großen Schlafsälen untergebracht (mit einer Nasszelle für alle). Die Zwangsmaßnahmen waren zwar zurückgegangen, aber immer noch waren Zwangsinjektionen, Festschnallen am Bett, Netz über dem Bett und Isolierzellen an der Tagesordnung. Die Mehrzahl der Hospitalisierten blieb länger als zwei Jahre im Krankenhaus.“ In dieser Situation kam es dann ab Ende der 1950er-Jahre mit einer deutlichen Katalysatorfunktion durch die öffentliche Darstellung der Zustände in den „Irrenhäusern“ zu einem zunehmenden Druck hin zu einer Reform der psychiatrischen Strukturen, so dass schließlich 1970 der Bundestag die Bundesregierung einstimmig ersuchte, eine Enquête über die Lage der Psychiatrie in der Bundesrepublik Deutschland zu erstellen.
Diesem Auftrag ging eine sich über zehn Jahre erstreckende Netzwerkarbeit im professionellen und politischen Raum voraus. Bereits in den 1950er-Jahren gab es vereinzelte Reformbemühungen und -ansätze, letztlich liefen diese Ansätze aber auf eine Reform auf der Grundlage der vorhandenen Strukturen hinaus. Ab der zweiten Hälfte der 1950er-Jahre kam es dann zu einem deutlichen Hinterfragen der vorhandenen Strukturen. So machte sich Prof. Dr. med. Jörg Zutt 1956 als Gründungspräsident der deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Neurologie/Nervenheilkunde (DGPN) Gedanken „über das psychiatrische Krankenhauswesen“. Er wies auf den erheblichen Reformbedarf hin, positionierte sich gegen den bestehenden Trend, Großkliniken mit mehr als 500 Betten zu schaffen. Stattdessen machte er sich für kleinere Abteilungen in den allgemeinen Krankenhäusern stark. 1957 erhielt Prof. Dr. med. Friedrich Panse, als T4-Gutachter tätig, trotz Anklage, aber entlastet, vom Vorstand der DGPN den Auftrag, ein Gutachten über „Entwicklung, Stand und Notwendigkeiten des psychiatrischen Krankenhauses“ zu erstellen. 1958 bildete sich ein informeller „Rhein-Main-Club“ junger Psychiater, dem unteren anderem Prof. Dr. med. Heinz Häfner, Prof. Dr. med. Casper Kulenkampff sowie Prof. Dr. med. Klaus Peter Kisker angehörten.
1959 wurde der deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge gegründet, dessen erster Vorsitzender, Prof. Dr. med. Walter Ritter von Baeyer, eine groß angelegte Reform der psychiatrischen Versorgung einforderte. Schließlich stellte Prof. Dr. med. Walter Schulte, Nachfolger von Prof. Dr. med. Ernst Kretschmer als Ordinarius in Tübingen, auf dem DGPN-Kongress in Bad Nauheim 1960 das Modell geschlossener gemischter Heil- und Pflegeanstalten in Frage. Da er seine Thesen öffentlichkeitswirksam vertrat, wurde er von seinem Amtsvorgänger in einem Brief getadelt. Kretschmer wiederholte letztlich in dem Schreiben an Schulte nur das, was gegen die Reformansätze in den 1950er-Jahren als Argument häufig vorgebracht wurde. Das Vertrauensverhältnis zwischen Patient und Arzt dürfe nicht durch öffentliche Kritik zerstört werden, außerdem sei die Öffentlichkeit nicht der richtige Ort, um Missstände zu benennen und Reformen zu debattieren.
In Rodewisch, in der DDR gelegen, wurde 1963 auf einer internationalen Tagung über die Zukunft der psychiatrischen Versorgung nach dem Mauerbau ein Austausch zwischen Ost und West ermöglicht. In den zum Abschluss der Tagung publizierten „Rodewischer Thesen“ wurde der Entwurf einer umfassenden Modernisierung der Versorgungsstrukturen vorgestellt, aus den großen geschlossenen Anstalten sollten kleine offene Kliniken entstehen. Ziel der Autoren war es, den Standort der psychiatrischen Disziplin zu bestimmen, ihre zukünftige Entwicklung zu umreißen und die Aufgaben der psychiatrischen Anstalten sowie der dort Tätigen neu zu definieren. Einer der an der Resolution beteiligten bundesrepublikanischen Psychiater war der Heidelberger Oberarzt Klaus Peter Kisker.
1964 nahm Kisker zusammen mit seinem Chef von Baeyer und seinem oberärztlichen Kollegen aus Heidelberg, Prof. Dr. med. Heinz Häfner, an einem Gespräch mit der damaligen Gesundheitsministerin Elisabeth Schwarzkopf teil, um mit ihr über „die Empfehlung zur zeitgemäßen Gestaltung psychiatrisch-neurologischer Einrichtungen“ zu sprechen, eine weitergehende politische Reaktion blieb aus. 1965 schließlich verfasste Heinz Häfner „unter Mitarbeit von W. v. Baeyer und K. P. Kisker“ eine Denkschrift zur „dringlichen Reform in der psychiatrischen Krankenversorgung der Bundesrepublik“. In ihr wird die aktuelle Lage (nochmals) schonungslos beschrieben. Vehement wurde auch die Forderung nach einer Öffnung der Behandlung durch die Mitarbeit von Psycholog*innen und Sozialarbeiter*innen sowie anderen Berufsgruppen gefordert. Zur damaligen Zeit war schließlich die These, fast alle psychisch erkrankten Menschen seien im Grunde rehabilitationsfähig, eine Hospitalisierung sei bei nur ca. 10 % aller bislang in psychiatrischen Institutionen untergebrachten Patienten notwendig, geradezu unerhört, stellte es doch die Existenz der Großkrankenhäuser mit mehreren hundert Betten infrage. Vielmehr sei die Hälfte der stationär untergebrachten Menschen einer ausschließlich ambulanten Behandlung zugänglich, weitere 40 % könnten von Hausärzten behandelt werden. Allein ein merkliches Echo blieb auch bei dieser Denkschrift aus.
Trotzdem kam es zu einer Beschleunigung der Entwicklung sowohl auf der professionellen als auch auf der politischen Ebene. Die Protagonisten der Psychiatriereform kamen in Leitungspositionen und konnten erste Reformansätze bereits in den 1960er-Jahren anstoßen. Walter von Baeyer wurde 1955 auf den Heidelberger Lehrstuhl berufen, er engagierte sich mit seinen Oberärzten Heinz Häfner und Klaus Peter Kisker.
In Heidelberg wurden in den frühen 1960er-Jahren die geschlossen geführten Stationen geöffnet, es wurden Tages- und Nachtklinik, ein Patientenclub sowie eine Werkstatt für chronisch erkrankte Menschen etabliert. Klaus Peter Kisker wurde 1966 auf das neu eingerichtete psychiatrische Ordinariat an die medizinische Hochschule Hannover berufen. Er organisierte die Sektorversorgung, die erste regionalen Versorgungsverpflichtungen einer psychiatrischen Hochschule. Heinz Häfner erhielt 1967 den Ruf auf den Lehrstuhl für Psychiatrie an der Fakultät für Medizin in Mannheim und leitete eine sozialpsychiatrische Klinik. Er hatte bereits 1963 in Heidelberg den Aufbau einer zweijährigen sozialpsychiatrischen Weiterbildung für das Krankenpflegepersonal etabliert. Caspar Kulenkampff wurde 1966 auf den Lehrstuhl für Psychiatrie an der Universität Düsseldorf berufen, damit verbunden die Leitung eines psychiatrischen Großkrankenhauses.
Da er als Ordinarius nicht glaubte, eine Strukturreform der Versorgung psychisch kranker Menschen entscheidend beeinflussen zu können, gab er 1971 den Lehrstuhl auf und begab sich als Dezernent im Landschaftsverband Rheinland an eine Schnittstelle zwischen Fachlichkeit und Politik. Bereits 1962 hatte er an der Frankfurter Universitätsklinik eine Tagesklinik sowie eine Nachtklinik und ein Übergangsheim initiiert.
1967 wandte sich der hessische CDU-Bundestagsabgeordnete Dr. h. c. Walter Picard, der durch sein privates Umfeld sensibilisiert und durch seinen Neffen, den Psychiater Prof. Dr. med. Manfred Bauer, informiert, an Heinz Häfner und Casper Kulenkampff. Picard wurde das wichtige Scharnier zwischen Experten und der Politik für die Verbesserung der Verhältnisse in der Psychiatrie.
Neben dieser notwendigen Verbindung gab es noch drei Einflusssphären, die letztlich zur Einsetzung der Enquête-Kommission beitrugen. So schrieb Häfner, es sei gelungen, einige wenige Journalisten für das Thema zu interessieren, so einen jungen Tübinger Arzt, der regelmäßig in der FAZ schrieb, Prof. Dr. med. Asmus Finzen. Mit der antiautoritären Studentenbewegung wurde die Ausrichtung der Psychiatriereform auch als sozialpolitische Bewegung, verbunden mit der Stimmung für einen grundlegenden Wandel, geschaffen.
Nicht zuletzt aber war es das Buch von Frank Fischer „Irrenhäuser. Kranke klagen an“, das 1969 erschien und ein herausragendes mediales Echo fand. Dieses Buch ist in seiner Wirkung auf die Psychiatriereform kaum zu unterschätzen, löste es doch gerade bei den jüngeren in der Psychiatrie Tätigen eine starke positive Resonanz aus und diente als Motivation für Veränderungen.
Als letztes seien die unterschiedlichen Tagungen erwähnt, die zum Teil nicht über ein Expertenforum hinausgingen und in der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen wurden. Auf diesen Tagungen traf sich jedoch ein „Who is who“ engagierter Reformpsychiater*innen und anderer in der Psychiatrie beschäftigter Menschen aus unterschiedlichen Berufsgruppen, die die Entwicklungen in Fachkreisen und Kliniken vorantrieben. Im Oktober 1970 schließlich fand im deutschen Bundestag ein Hearing zur Situation der psychisch Kranken in Deutschland statt.
Mit Hilfe dieser unterschiedlichen Verbindungen zwischen Politik, Verwaltung und Experten der internen fachöffentlichen Auseinandersetzung, der Aufdeckung von skandalösen Zuständen in der Psychiatrie in den Medien, den antiautoritären Impulsen der 1968er-Bewegung, wurde ein sich gegenseitig verstärkendes Klima geschaffen, mit dessen Hilfe Walter Picard dann erfolgreich die erste Enquête-Kommission im deutschen Bundestag einstimmig etablieren konnte.
Die Sachverständigenkommission bestand zunächst aus 18 Mitgliedern, Experten und Vertretern der Politik. Zum Vorsitzenden wurde Casper Kulenkampff, als sein Stellvertreter Heinz Häfner gewählt. In zehn Arbeitsgruppen wurden die Themen bearbeitet und von einem zentralen Redaktionsteam zusammengefasst. Im Oktober 1973 wurde der Zwischenbericht der Kommission vorgelegt. Asmus Finzen schreibt dazu am 6. November 1973 in der FAZ „... dass eine sehr große Anzahl psychisch Kranker und Behinderter in den stationären Einrichtungen unter elenden, zum Teil als menschenunwürdig zu bezeichnenden Umständen“ leben muss. „Überalterung der Bausubstanz, katastrophale Überfüllung in diesen Bereichen, Unterbringung in Schlafsälen, unzumutbare sanitäre Verhältnisse und allgemeine Lebensbedingungen, vor allem für chronisch Kranke, kennzeichnen einen gegenwärtigen Zustand, dessen Beseitigung nicht einfach auf unabsehbare Zeit verschoben werden kann“.
Der Abschlussbericht und die Folgen
Die zentralen Empfehlungen des Abschlussberichtes umfassen den Aufbau eines gemeindenahen Versorgungssystems mit psychiatrischen Abteilungen in Allgemeinkrankenhäusern sowie der Einrichtung komplementärer Dienste. Die Verkürzung der Aufenthaltsdauer und eine deutlich verbesserte und neue Berufsgruppen umfassende Personalausstattung. Sozialpolitische Maßnahmen mit z. B. Förderung der beruflichen Wiedereingliederung, Arbeitstherapie, Integrationshilfe. Forschung und Qualitätssicherung durch die Einrichtung von Modellprojekten zur Evaluation moderner Versorgungsformen. Weiterhin die vorrangige Verbesserung der Versorgung psychisch kranker Kinder und Jugendlicher sowie Alkohol- und Suchtkranker und alter Menschen. Die Gleichstellung körperlicher und seelisch Kranker in rechtlicher, finanzieller und sozialer Hinsicht. Asmus Finzen sieht die Enquête aus heutiger Sicht als ein eher konservatives Dokument. So habe sich die Expertenkommission nicht von der Krankenhaus- und Bettenzentrierung gelöst, es würde noch einmal gut 20 Jahre dauern, bis es zunächst vereinzelt gelang, Modellprojekte zu etablieren, die nicht das Bett, sondern die Bedürfnisse psychiatrisch erkrankter Menschen in den Mittelpunkt stellten. Hier sind vor allen Dingen die Modellprojekte in Itzehoe, Geesthacht und Heide zu nennen. Zwar wurde in Mannheim mit dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit unter deren Leiter 1975 die Forderung nach Modellprojekten erfüllt, es blieb aber eines von wenigen.
Es gab deutliche Veränderungen im Zuge der Enquête-Empfehlungen: Wiederaufbau sozialpsychiatrischer Dienste an den Gesundheitsämtern, Einrichtung von Tageskliniken, Übergangsheimen, Tagesstätten, Reha-Werkstätten, deutlicher Rückgang der aufgestellten Betten mit einer Verkürzung der Verweildauer, Einrichtung von betreutem Wohnen zuhause, Umwandlung alter polizeilicher Unterbringungsgesetze zu Psychisch Krankenhilfegesetzen, Stärkung der Patient*innen-Rechte, der Anerkennung der UN-Behindertenkonventionen durch den Bundestag und vieles mehr.
Es musste aber auch mehr als ein Jahrzehnt vergehen, bis die Teilhabe von Betroffenen und Angehörigen überhaupt ins Blickfeld trat, sich beispielsweise ein Trialog zwischen Betroffenen, Angehörigen und Professionellen etablierte. Gab es Anfang der 1970er-Jahre 20 Kliniken an Allgemeinkrankenhäusern, sind es heute mehr als 200.
Erwähnt werden muss auch die Personalverordnung Psychiatrie, die erstmals Patienten mit vergleichbaren Behandlungsbedarf mit Behandlungszielen definierte und daraus den Bedarf an Personalstellen ableitete.
Bei all den Veränderungen hin zu einer menschenwürdigen Psychiatrie blieb ein Teil der fortschrittlichen psychiatrischen Öffentlichkeit doch skeptisch. Es sei keine echte Reform, eher ein Minimalkonsens, eine Aneinanderreihung von Forderungen und Lösungsvorschlägen unterschiedlicher Interessengruppen.
In der Nachbetrachtung spricht Cornelia Brink davon: „Im Wesentlichen fanden sich in der Enquête zwei Positionen nebeneinander: eine strukturkonservative Lösung, die auf den quantitativen Ausbau der Kliniken, mehr Betten und mehr Personal setze, und eine auf Strukturveränderungen setzende Lösung, die ein Konzept der Ausdifferenzierung mittels ergänzender teilstationärer und ambulanter Einrichtungen mit dem Ziel vertrat, den stationären Sektor langfristig zu verkleinern. 50 Jahre nach der Enquête scheint sich die Ausdifferenzierung durchgesetzt zu haben.
Stillstände und Rückschritte
Es gibt aber auch deutliche Stillstände und Rückschritte. Durch die Politik seit Beginn der 1980er-Jahre veränderte sich auch das psychiatrische Denken: kollektive Leistungen wurden zurückgedrängt, persönliche Leistungen und Eigeninitiative gefördert. Damit einher gingen der Aufbau von Projektorientierung sowie die Verlagerung von Aufgaben auf Selbsthilfe (Organisationen). Dadurch erfolgte eine Verlagerung der Verantwortung vom Fürsorgestaat auf die Betroffenen. Die 2013 eingeführte Entgeltregelung für die psychiatrischen und psychosomatischen Abteilungen führte zu einer radikalen Umorganisation der Psychiatrie. Die Anzahl von Heimunterbringungen hat, ebenso wie die im Rahmen des Maßregelvollzugs, zugenommen. Auch die aktuelle Debatte über die Erstellung von Listen „potenziell gefährlicher Menschen mit psychischen Erkrankungen“, wie die aktuelle Diskussion u. a. in Hessen etwa zeigt, kann erneut zu einer Stigmatisierung, Ausgrenzung und Ablenkung führen.
Unbestreitbar bleibt allerdings; durch die Enquête wurde auf die menschenunwürdigen Bedingungen in den psychiatrischen Anstalten in der Öffentlichkeit hingewiesen, diese diskutiert und dadurch ein Prozess angestoßen, der wirkungsvoll und nachhaltig war, letztlich bis heute andauert.
Prof. Dr. med. Heiner Fangerau vertrat vor kurzem die These, ein Grund für die Modernisierung der psychiatrischen Versorgung bestehe in der damaligen Zunahme von Zivildienstleistenden in den Anstalten und Heimen. Zumindest für das UKE kann ich dies bestätigen, es wurde Besteck auf der Aufnahmestation eingeführt, Krankenpflegeschülerinnen kamen auf die Station, es gab Begegnungsmöglichkeiten zwischen den Patientinnen und den Patienten der geschlechtlich getrennten Aufnahmestationen. Mit den Patienten wurden die Glasbausteine zu den Toiletten gestrichen, so dass etwas Privatsphäre und Menschenwürde Einzug hielt.
Dr. med. Michael Putzke, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie; Psychoanalyse, Gruppenanalyse, E-Mail: michael.putzke@gz-wetterau.de